2019: Hundert Jahre Bauhaus
Sie glaubten, in Weimar – dieser Stadt aufgeschlossener Klassik – endlich in künstlerischer wie auch gesellschaftlicher Weise so leben und arbeiten zu können, wie sie es sich wünschten – nicht gegängelt, vielleicht auch ein wenig zügellos. Außerdem hatte einer von ihnen, Walter Gropius, sehr private Bindungen an die Stadt Goethes, Schillers, Bachs und Händels, denn hier wirkte sein Freund Henry van de Velde als Direktor der Staatlichen Kunstgewerbeschule. Über ihn auch hatte Gropius einflussreiche großherzogliche Beamte kennen gelernt. Verlockend war auch das Wort „staatlich“ im Namen der Hochschule, denn damit war sie finanziell gesichert – der Staat zahlte ja.
Gropius konnte nicht einmal zeichnen – von der Uni geflogen
Weimar aber war auch anderweitig noch verheißungsvoll für die Künstler einer Moderne, wie sie das 1918 zusammengebrochene Kaiserreich nicht erlaubt hätte. Mit Weimar wurde auch deshalb absolute künstlerische Freiheit verbunden, weil hier Deutschlands erste wahrhaft demokratische Verfassung beschlossen und verkündet wurde und weil Weimar zeitweise – für einige Monate – Sitz der Nationalversammlung und Regierung war, die dem revolutionären und vom Bürgerkrieg bedrohten Berlin den Rücken gekehrt hatten.
Warum heißt das Bauhaus überhaupt Bauhaus ?
Warum diese neue Schule in Weimar „Bauhaus“ genannt wurde, konnte nie wirklich und überzeugend geklärt werden. Eine sehr plausible Version: Der Name soll an die Bauhütten des Mittelalters erinnern, in der alle handwerklichen Richtungen zusammenarbeiteten. Im Weimarer Bauhaus waren tatsächlich alle Künste vertreten – die Architektur eines Hauses wie auch dessen Einrichtung und die dazu erforderlichen Gewerbe und Handwerksbetriebe. Im April 1919 wird Walter Gropius Direktor des Bauhaus Weimar, obwohl ihm – und das allein schon ist einmalig in einer solchen Karriere – entscheidende Talente dafür fehlen. So kann er beispielsweise nicht einmal zeichnen. Aber: Er kommt, wie es so schön heißt, „aus geordneten Verhältnissen“: Sein Vater ist Geheimrat, sein Großvater vielfach dekorierter preußischer Staatsrat, Großonkel Martin Gropius brilliert als bekannter und erfolgreicher Architekt.
Genau das will auch Walter Gropius werden. Er beginnt in Berlin das Studium der Architektur, obwohl er – es sei wiederholt! – nicht einmal zeichnen kann. Deshalb auch bricht er dieses Studium ab, aber dank privater Mauscheleien und „Unter-der-Hand-Szenarien“ und mit Hilfe des Großonkels findet er eine Anstellung im angesehenen Berliner Architekturbüro Behrens. Da trifft er Talente und Größen wie Mies van der Rohe und Le Corbusier und wird regelrecht zum Filou: Er vermittelt diesen seine Ideen, deren Vielfalt wahrhaftig sensationell ist und lässt sie auf diese gewagte Weise realisieren. Besser: Er „erzählt“ sein Vorhaben, seinen Plan, und er lässt das die anderen zeichnerisch und architektonisch ausführen. Er sprach damals von sich als „Faktotum“, was der Architekturhistoriker und Präsident der Bayerischen Akademie der Künste Winfried Nerdinger als „Unfähigkeit, auch nur das Einfachste auf Papier zu bringen“ analysiert. Gropius hat seine Schwächen nie kaschiert, hat zu ihnen gestanden. Er verwendete wohl deshalb auch oft das Wort „Team“, wenn er von seinem Arbeiten sprach. Einige Biographen sind sich sicher: Hätte er das Studium in Berlin nicht von sich aus beendet, wäre er von der Uni geflogen. Dieses absolute „Nicht-Talent“ soll trotz allem eine bemerkenswerte und weltweit anerkannte, wenn auch nicht unumstrittene Architektenkarriere geradezu „hinlegen“. 1910 macht er sich als Industriedesigner und Architekt selbstständig, aber immer – zeitlebens! – ist er auf die Hilfe und Unterstützung zeichnerisch begabter Mitarbeiter angewiesen. „Team“-Arbeit eben.
Im Ersten Weltkrieg (1914 bis 1918) diente er als Unteroffizier der Reserve. Ab 1919 war er in Berlin „Revoluzzer“, Mitglied etwa im kommunistisch dominierten „Arbeitsrat für Kunst“. Diese Gruppe löste sich 1921 auf. Zuvor noch – 1919 – wurde Gropius auf Vorschlag Henry van de Veldes dessen Nachfolger als Direktor der Großherzoglich-Sächsischen Hochschule für Bildende Kunst in Weimar. Er änderte diesen Namen um in „Staatliches Bauhaus Weimar“ und versammelte um sich die führenden Architekten dieser Zeit – allesamt, darf konstatiert werden, „Revoluzzer“. Und das auf jedem Gebiet – in der Politik, ihrer Kunst, ihrem Lebenswandel, letzteres bis hin zur freien Liebe in stetig wechselnden Gruppen. Gropius etwa begann eine Liaison mit Alma, der Frau des weltberühmten Komponisten Gustav Mahler. Es folgt eine mehrjähriger Epoche der Leidenschaften und Liebe, der Eifersucht und des Fremdgehens. Nach Mahlers Tod heiratet Alma Gropius – der setzt sein zügelloses Dasein fort.
Das konnte im beschaulichen, verbeamteten, stur konservativen Weimar nicht lange gut gehen. Nicht nur die Bevölkerung entwickelte eine regelrechte Feindschaft gegen das Bauhaus und seine avantgardistischen Künstler – bei der Landtagswahlen 1924 siegten die Konservativen. Am 2. Weihnachtsfeiertage kündigte Gropius deshalb an, seine Schule in Weimar zu schließen. Mehrere Städte, auch Köln und Frankfurt/Main, bewarben sich um das aus Weimar vertriebene Bauhaus. Doch Gropius und Anhang wollten nicht in eine Metropole – deshalb erhielt das übersichtlichere und gemütlichere Dessau den Zuschlag.
Dessau und das Bauhaus
In 15 Monaten enstand das Bauhaus in Dessau
Nach nur 15 Monaten Bauzeit – Berlins Großflugplatz BER und sein Schlossneubau kommen einem in den Sinn – wird das Dessauer Bauhaus-Gebäude Weihnachten 1926 eröffnet.
Danach tritt Gropius zurück, er will sich in Berlin ausschließlich seiner Architektur widmen. Nachfolger wird er Schweizer Kommunist Hannes Meyer, der dieser Gesinnung wegen 1930 von der Stadt Dessau entlassen wird. Jetzt übernimmt Ludwig Mies van der Rohe. 1931 gewinnen die Nazis die Dessauer Lokalwahlen. Deshalb zieht das Bauhaus als „Privatinstitut“ nach Berlin-Steglitz. Die Nazis lassen nicht locker. Nachdem die Gestapo (Hitlers Geheime Staatspolizei) im Frühjahr 1933 einige Dutzend Studenten verhaftet, löst sich die Schule selbst auf. Viele Dozenten und Studenten emigrieren.
Gropius geht zunächst nach England, 1937 dann in die USA. An der Harvard University wird er Professor für Architektur. In seinen letzten Lebensjahren ist er häufig in Deutschland. In Berlin etwa errichtet er im Rahmen der HINTERBAU im Hansaviertel 1957 einen neungeschossigen Wohnblock, dessen konkave Südfront und das offene Erdgeschoss als typischer Beispiel einer „späten Moderne“ gelten. Im Süden Berlins – Neukölln – verwirklicht er seine schon in Weimar mit dem „Haus am Horn“ praktizierte Plattenbauweise in größtmöglichen Stil: Hier entsteht zwischen 1961 und 1975 die Gropiusstadt, ein Stadtteil mit 18 500 Wohnungen für rund 40 000 Menschen. 90 Prozent davon sind Sozialwohnungen. Noch während der nach ihm benannte Stadtteil im Bau ist, stirbt Gropius im Juli 1969 in den USA.
Seine „Hinterlassenschaften“ sind Legion. Vielfach weltweit bekannte Gropius-Ikone, wie etwa das Pan Am-Gebäude in New York, 60 Stockwerke hoch, einst mit Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach – Direktverbindungen zu den Flughäfen der Stadt am Hudson.
Dieser Walter Gropius war schon ein Genie – sogar ein extrem geniales. Hier ein weiterer Beitrag von Wolfgang Will auf einfachraus.eu.
Buchtipp zum Bauhaus
Was ist „das Bauhaus“? Warum beeinflusste diese Kunstschule das Design, die Architektur und das moderne Leben so immens? 50 pointierte Antworten erzählen von den Bauhäuslern – von Selbstversorgern, Visionären, Experimentierversessenen und Partylöwen. Von bahnbrechender Architektur und unschlagbarem Design. Sie erzählen auch, wie sich das Bauhaus in Deutschland, Israel und den USA weiterentwickelte. Die Illustrationen von Halina Kirschner geben dem Buch eine unverwechselbare Ästhetik.

Gesine Bahr (Text) / Halina Kirschner (Illustration): Das ist das Bauhaus! 50 Fragen – 50 Antworten (E. A. Seemann), 19,95 Euro
Hier weitere Beiträge zum Bauhausjubiläum 2019 auf einfachraus.eu
+
+
+

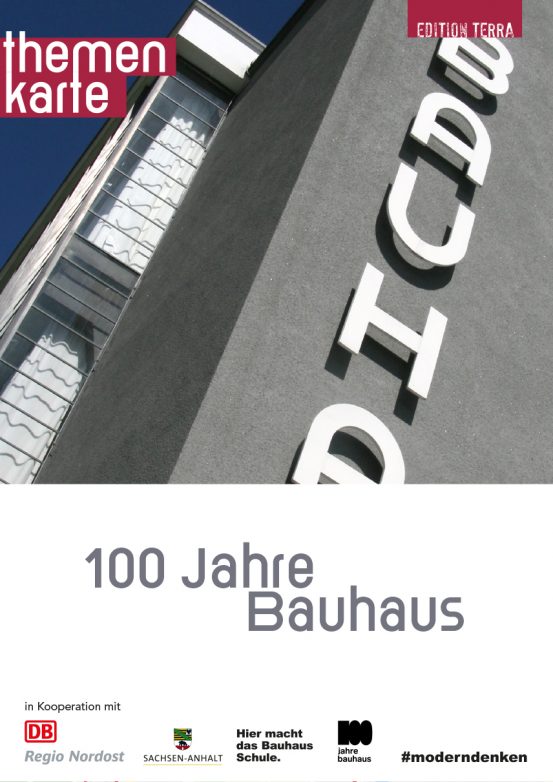










Hinterlasse einen Kommentar